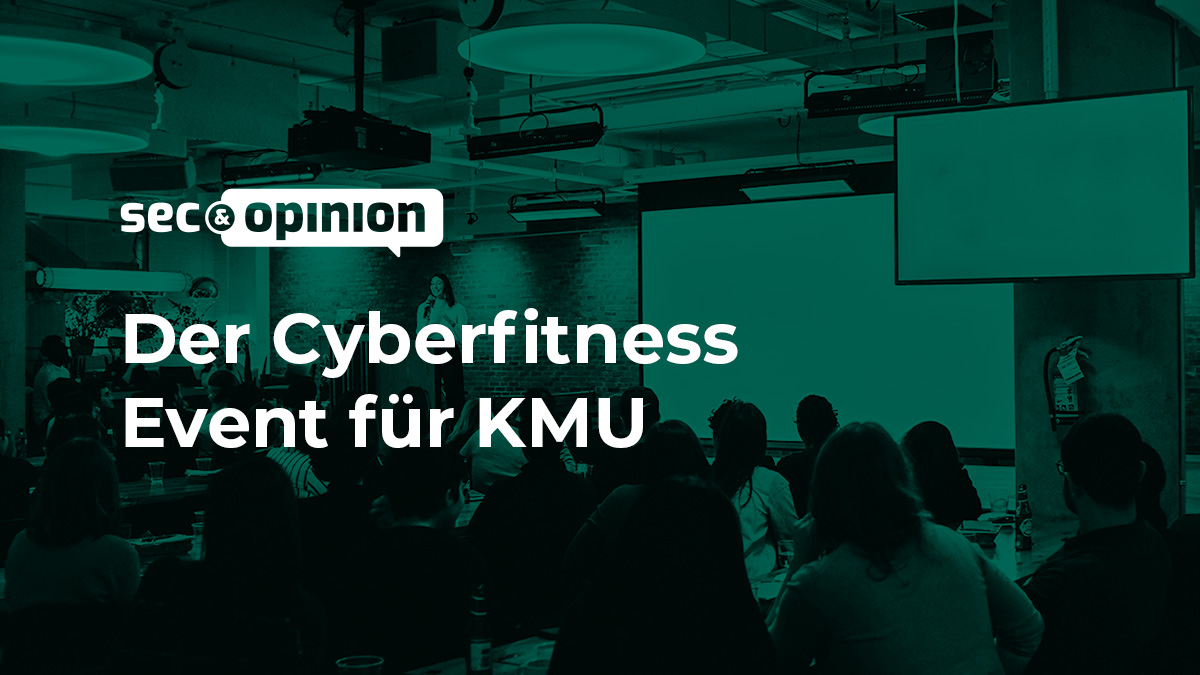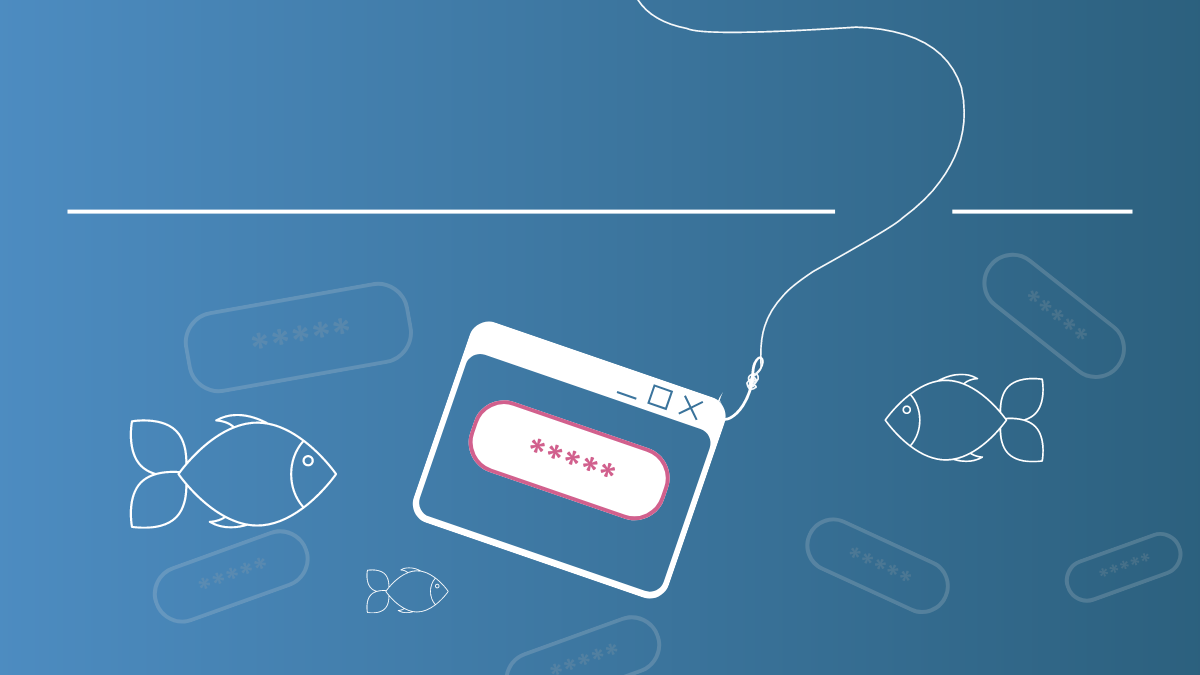Menschliche Widerstände abbauen und KI-Nutzung fördern

KI ist gekommen, um zu bleiben. Die Effizienzgewinne durch künstlich-intelligente Assistenten sind gerade in klassischen Büro-Jobs immens. Was aber, wenn dieses Potenzial nicht ausgeschöpft wird, weil die Menschen die Tools nicht nutzen? Die Gründe dafür sind vielfältig. Fakt ist: Der Mensch ist der Schlüssel für eine erfolgreiche KI-Nutzung. In diesem Blogbeitrag werden unterschiedliche menschliche Widerstände gegenüber technologischen Neuerungen beleuchtet. Viel wichtiger aber: Wir zeigen auf, wie Sie diesen begegnen und die KI-Nutzung fördern können.
Der Blogbeitrag wird in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Elisa Konya-Baumbach von der humest GmbH erstellt.

KI in der Schweiz: Zwischen Potenzial und Zurückhaltung
Laut dem Swiss AI Report 2025 setzen nur 19 Prozent der Schweizer Unternehmen KI regelmässig ein. Ganze 33 Prozent nutzen sie noch gar nicht. Die Zahlen zeigen: Das Interesse ist zwar da – die Implementierung in der Praxis hinkt allerdings. Die Zurückhaltung hat verschiedene Gründe. 47 Prozent der Mitarbeitenden haben gemischte Gefühle gegenüber KI. Bei 41 Prozent gibt es vereinzelte Widerstände, bei 5 Prozent sogar deutliche Ängste. Besonders alarmierend: 20 Prozent der Unternehmen wissen gar nicht, ob es in ihren Reihen Vorbehalte gibt.
Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren oder konkrete Fragen stellen? Prof. Dr. Elisa Konya-Baumbach ist Gast an unserem Webinar vom 16. September 2025. Es wird nicht aufgezeichnet und findet ausschliesslich live von 11 bis 12 Uhr statt.
Emotionen und Ängste: Die menschliche Seite der KI
Die Hürden, warum wir KI noch nicht nutzen, sind vorwiegend menschlicher, statt (wie womöglich angenommen) technischer Natur. Nachfolgend einige Barrieren, die einer breiten KI-Akzeptanz im Weg stehen:
- Rechtliche Unklarheiten und fehlende Regelwerke im Unternehmen, bspw. KI-Richtlinien
Ohne offizielle unternehmensinterne Handhabungen sind Mitarbeitende verunsichert, ob und welche KI-Tools, wie eingesetzt werden dürfen.
- Hoher Workload und schlechte Bedienbarkeit
Das Austesten neuer Arbeitsmittel oder -abläufe benötigt Zeit. Zu Beginn wohl sogar mehr, als wenn die Aufgabe auf herkömmliche und/ oder manuelle Art und Weise erledigt würde. Der Effizienzgewinn tritt erst nach mehrmaliger Anwendung auf. Deswegen müssen zum Ausprobieren von KI-Assistenten zeitliche Ressourcen freigesprochen und mögliche Anwendungsfälle aufgezeigt werden.
- Mangelnde Aufklärung und fehlende Verantwortung
Mitarbeitende müssen nicht nur über die KI-Anwendungen an sich, sondern auch über die Haltung und die Stossrichtung des Unternehmens informiert werden. Die zuvor erwähnten, zugesprochenen Ressourcen müssen intern transparent kommuniziert und für allfällige missglückte Versuche in der Testphase die Verantwortung übernommen werden. Dazu ist eine offene Fehlerkultur im Unternehmen unabdingbar.
- Existenzängste und Algorithm-Aversion
Die Angst, dass KI einem den Job und damit die Existenzgrundlage wegnehmen könnte, ist im Zusammengang mit der KI-Revolution in den Medien breit diskutiert. Zusätzlich gibt es die sogenannte Algorithm-Aversion, also die Tendenz, dass manche Menschen automatisierten Entscheidungen durch KI generell skeptisch gegenüber eingestellt sind. Es ist zudem psychologisch verankert, dass wir Menschen Neuerungen per se einmal kritisch gegenüber eingestimmt sind, auch Status Quo Bias genannt.
Aus diesen Gründen ist es wichtig, die menschliche Komponente als Erfolgsfaktor in der KI-Revolution mitzuberücksichtigen.
Schritt für Schritt zur Akzeptanz
Das von der humest GmbH entwickelte Phasenmodell zur KI-Akzeptanz zeigt: Der Weg zur Integration verläuft in Etappen. Jeder Mensch, jedes Team und jedes Unternehmen durchläuft diesen Prozess individuell und oft nicht linear. Es geht also manchmal vor, manchmal aber auch wieder zurück.
Die eine Lösung gibt es nicht. So viel vorneweg. Es braucht individuelle, barrierenspezifische Ansätze – und vor allem Empathie. Denn nur wenn wir die Ängste, Fragen und Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen, kann KI ihr volles Potenzial entfalten.
Möchten Sie das Phasenmodell, die Herausforderungen in jeder Phase und mögliche Ansätze, ihnen zu begegnen, genauer kennen lernen? Gerne geben wir Ihnen das Know-How aus dem Webinar vom 16. September 2025 weiter. Buchen Sie sich Ihren kostenlosen Austausch bei Lars oder Simon.